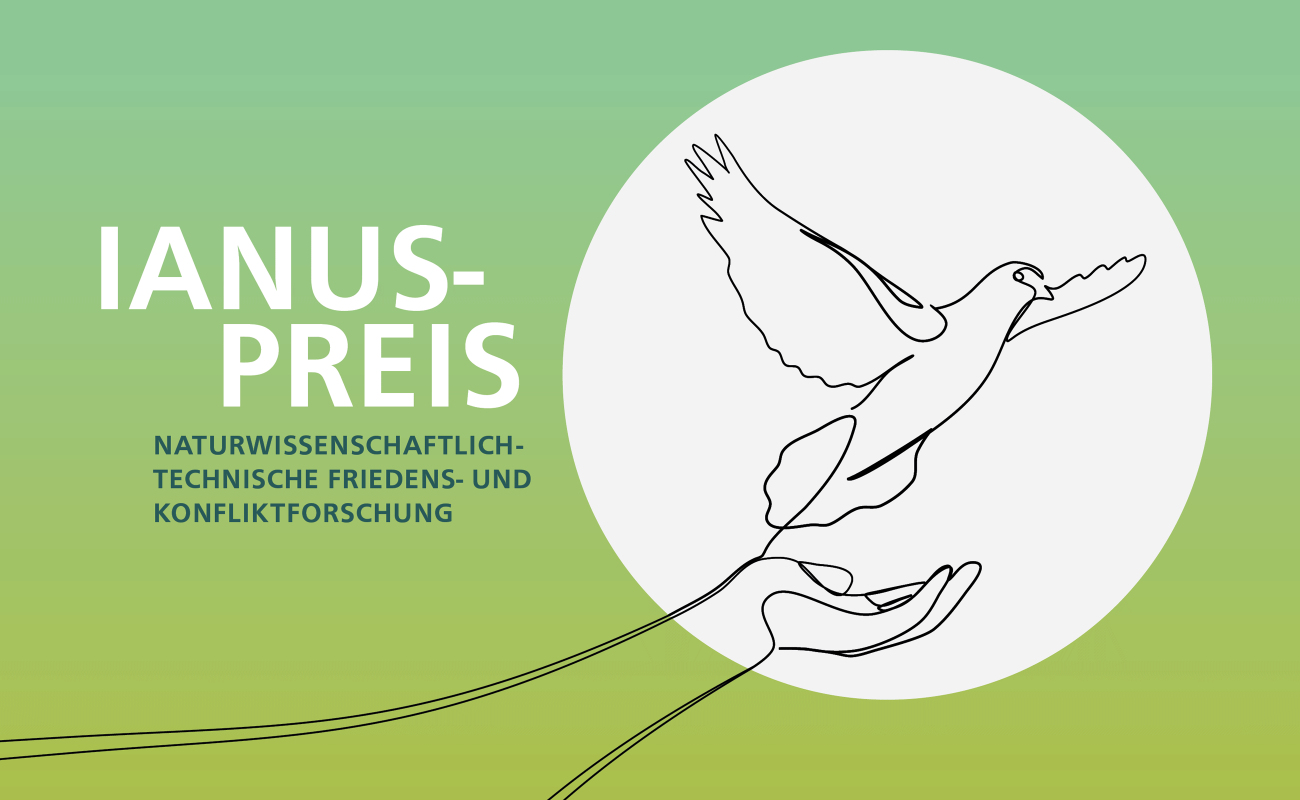IANUS-Preis
Ausschreibung 2026
Eingereicht werden können bis zum 31. Juli 2026 Qualifikationsarbeiten (insb. Studien/Projekt-, Bachelor-, Masterarbeiten, Publikationen oder Dissertationen) der TU Darmstadt, die seit August 2024 abgeschlossen wurden und sich mit IANUS relevanten Fragestellungen beschäftigen.
Der Preis (1.000 Euro) prämiert herausragende Qualifikationsarbeiten aus allen Fachrichtungen der TU Darmstadt, die in einem IANUS-Bezug stehen, d.h. die Fragestellungen der naturwissenschaftlich-technischen Friedens- und Konfliktforschung bearbeiten, oftmals interdisziplinär unter Einbeziehung der Sozial- und Geisteswissenschaften betrachten.
2026 wird der Preis erneut verliehen und eingereicht werden können bis zum 31. Juli 2026 Qualifikationsarbeiten (insb. Studien/Projekt-, Bachelor-, Masterarbeiten, Publikationen oder Dissertationen), die seit August 2024 abgeschlossen wurden und sich mit IANUS relevanten Fragestellungen beschäftigen.
Wir bitten um Nominierungen, einschließlich Selbst-Nominierungen unter dem Betreff „IANUS-Preis“ an ianus-preis@peasec.de. Beizufügen ist eine PDF-Version der vorgeschlagenen Arbeit, eine Begründung für deren Preiswürdigkeit (i.d.R. des Betreuers) sowie optional weitere Anhänge (Lebenslauf, Gutachten).
Arbeiten thematisieren eine Vielzahl möglicher Themenfelder.
- Dual Use
- Nachhaltige Entwicklung
- Gerechtigkeit
- Wertorientierte Sicherheitsforschung
- Die Ambivalenz des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
- Internationale Konflikte
- Vulnerabilität und Resilienz
Mitglieder der IANUS-Jury sind Prof. Dr. Markus Lederer (Internationale Politik), Prof. Dr. Dr. Christian Reuter (Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit) und Prof. Dr. Malte Göttsche (Naturwissenschaftliche Friedensforschung).
Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie Themenbeispiele
Preisverleihung am 26. November 2025
Preisträgerinnen und Preisträger 2025:
Vier Arbeiten zu Biodiversität, Informations-Souveränität, KI-Ethik sowie Kontrolle autonomer Systeme ausgezeichnet
Die Technische Universität Darmstadt hat am 26. November die IANUS-Preise 2025 für herausragende Qualifikationsarbeiten im Bereich naturwissenschaftlich-technischer Friedens- und Konfliktforschung verliehen. IANUS steht für natur- und ingenieurwissenschaftliche Friedensforschung im Austausch mit den Sozial- und Geisteswissenschaften und versteht sich als multi- und transdisziplinäres Netzwerk von Forschern an der TU Darmstadt. Der insgesamt mit 1.500 Euro dotierte Preis würdigt herausragende Qualifikationsarbeiten aus allen Fachrichtungen der Universität, die sich interdisziplinär mit Fragen von Frieden, Sicherheit und gesellschaftlicher Verantwortung befassen.
Den 1. Platz mit jeweils 500 Euro Preisgeld erhielten Dr. Johanna Berger (Biologie) für ihre Dissertation zu den Auswirkungen des Mähens auf Insekten und Spinnen sowie praxisnahen Maßnahmen gegen den Biodiversitätsverlust und Dr. Lukas Struppek (Informatik) für seine Arbeit zu Sicherheits-, Datenschutz- und Ethikrisiken generativer KI sowie technischen Gegenmaßnahmen. Den 2. Platz mit je 250 Euro Preisgeld teilten sich Dr. Tom Biselli (Informatik) mit seiner Dissertation zur Informationssouveränität und nutzerzentrierten digitalen Interventionen gegen Datenmissbrauch und Fehlinformation sowie Anna-Maria Kugler, M.Sc. (Cognitive Science) mit ihrer Masterarbeit zu Strategien für menschliche Kontrolle über KI- und autonome Systeme. Die prämierten Arbeiten zeigen, wie interdisziplinäre Forschung innovative Beiträge zu Frieden, Sicherheit und gesellschaftlicher Verantwortung leistet. Auch im kommenden Jahr wird der IANUS-Preis wieder vergeben.
Ausführliche Begründung
Dr. rer. nat. Johanna Berger für ihre Dissertation im Fachbereich Biologie mit dem Titel „In the eyes of biodiversity loss: Disentangling mowing impacts on grassland arthropods and finding applied solutions“, betreut von Prof. Dr. Nico Blüthgen und Apl. Prof. Dr. Michael Heethoff
Der fortschreitende Biodiversitätsverlust infolge intensiver Landnutzung erfordert konkrete Lösungsansätze. In ihrer Dissertation belegt Johanna Berger die negativen Auswirkungen auf Insekten und Spinnen durch das Mähen von Grünland in Deutschland. Große ökologische und experimentelle Datensätze zeigen den Einfluss verschiedener Mähtechniken auf Insekten und Spinnen sowie den positiven Effekt ungemähter Bereiche, sogenannter Refugien.
Mit einem inter- und transdisziplinären Ansatz werden anwendungsorientiert Synergien für Mensch und Umwelt in der Praxis gesucht. Ein Beispiel ist das Online-Webtool „Insektentaschenrechner“, mit dem jede*r die Auswirkungen der Mahd auf Arthropoden auf verschiedenen Flächen selbst berechnen kann. Die Arbeit beleuchtet nicht nur die ökologischen Folgen der Mahd, sondern auch, wie Umweltbildung, Dialog mit der Praxis und Wissenschaftskommunikation zur Eindämmung der Biodiversitätskrise beitragen können.
Dr. rer. nat. Lukas Struppek für seine Dissertation im Fachbereich Informatik mit dem Titel „Understanding and Mitigating Security, Privacy, and Ethical Risks in Generative Artificial Intelligence“, betreut von Prof. Dr. Kristian Kersting, mit dem Korreferenten Prof. Dr. Daniel Neider. Die vorliegende Dissertation untersucht neuartige Risiken, die mit der Entwicklung und dem Einsatz generativer KI-Systeme verbunden sind. Dabei werden zwei zentrale Perspektiven eingenommen: Zum einen wird analysiert, wie generative Modelle als Werkzeuge missbraucht werden können, um klassische Machine-Learning-Systeme, etwa Gesichtserkennungstechnologien, anzugreifen und sensible Informationen aus den Trainingsdaten zu rekonstruieren, beispielsweise das Aussehen einzelner Personen. Zum anderen wird betrachtet, inwiefern generative KI-Systeme selbst zum Ziel von Angriffen und Manipulationen werden können. Im Fokus stehen hierbei spezifische Schwachstellen von Diffusionsmodellen, darunter die unbeabsichtigte Memorierung von Trainingsdaten, gezielte Modellverzerrungen durch Unicode-Manipulationen sowie das Einschleusen versteckter Backdoor-Funktionalitäten. Neben der systematischen Analyse solcher Angriffsvektoren präsentiert die Arbeit verschiedene technische Lösungsansätze, die dazu beitragen, Machine-Learning-Modelle widerstandsfähiger gegenüber Angriffen und Manipulationen zu machen.
Anna-Maria Kugler, M.Sc. für ihre Masterarbeit im Fach Cognitive Science mit dem Titel „Strategies for Maintaining Human Control in AI-Enabled and Autonomous Systems: A Systematic Literature Review“, betreut von Dr. Thea Riebe. Die Thesis befasst sich mit der Frage, wie menschliche Kontrolle über KI-basierte und autonome Systeme gewährleistet werden kann. Innerhalb einer umfassenden systematischen Literaturanalyse werden Strategien menschlicher Kontrolle und Aufsicht in verschiedenen Anwendungsbereichen erfasst. Darauf aufbauend entwickelt die Arbeit eine Taxonomie, die diese Strategien entlang mehrerer Dimensionen einordnet, wie dem Grad menschlicher Beteiligung, der Anwendungsdomäne, den Auslösefaktoren sowie der Interaktionsstrategie. Die Analyse zeigt, dass in verschiedenen Domänen unterschiedliche Interaktionsansätze zu umfassenden Kontrollstrategien kombiniert werden, was domänenspezifische Anforderungen widerspiegelt. Zudem wird verdeutlicht, dass Kontrolle kein einseitiger Prozess ist, sondern sowohl das System als auch NutzerInnen aktiv dazu beitragen. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass das Design nutzerzentrierter KI-Systeme darauf abzielen sollten, menschliche Autonomie zu fördern und Menschen bei der Ausübung effektiver Kontrolle zu unterstützen.
Dr. rer. nat. Tom Biselli für seine Dissertation im Fachbereich Informatik mit dem Titel „Individual Information Sovereignty: User Perspectives and Digital Interventions for Navigating Privacy and Misinformation“, betreut von Prof. Dr. Dr. Christian Reuter, mit dem Korreferenten Prof. Dr. André Calero Valdez. Die Dissertation befasst sich mit der Frage, wie Individuen in zunehmend undurchsichtigen digitalen Umgebungen im Umgang mit digitalen Informationsflüssen unterstützt werden können. Im Fokus stehen dabei zwei Richtungen: (1) die Preisgabe sensibler Daten im Kontext der Privatsphäre und (2) der Konsum von Informationen, insbesondere von Fehlinformationen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entwickelt die Dissertation das Konzept der Informationssouveränität, verstanden als Autonomie, Kontrolle und Kompetenz im Umgang mit digitalen Informationsflüssen. Mit qualitativen und quantitativen Methoden werden konzeptionelle Einsichten, Nutzerperspektiven und digitale Interventionen untersucht. Die Ergebnisse verdeutlichen die Heterogenität von Nutzerperspektiven und das Potenzial transparenter, personalisierter Interventionen in Bereichen wie Browser-Cookies sowie text-, video- und diagrammbasierter Fehlinformationen. Insgesamt bietet die Dissertation damit eine nutzerzentrierte Perspektive aus der Mensch-Computer-Interaktion darauf, wie eine informierte und selbstbestimmte Navigation digitaler Informationsflüsse ermöglicht werden kann.
Die ausgezeichneten Arbeiten des IANUS-Preises 2025 zeigen eindrucksvoll die Vielfalt der IANUS-Forschung an der TU Darmstadt – von ökologischen Fragestellungen über digitale Informationssouveränität bis hin zu ethischen und sicherheitsrelevanten Aspekten künstlicher Intelligenz. Sie verdeutlichen, wie inter- und transdisziplinäre Ansätze innovative Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen ermöglichen und den Brückenschlag zwischen Wissenschaft, Praxis und Verantwortung meistern. Damit unterstreicht der IANUS-Preis erneut die zentrale Rolle naturwissenschaftlicher Beiträge für Frieden und Sicherheit.